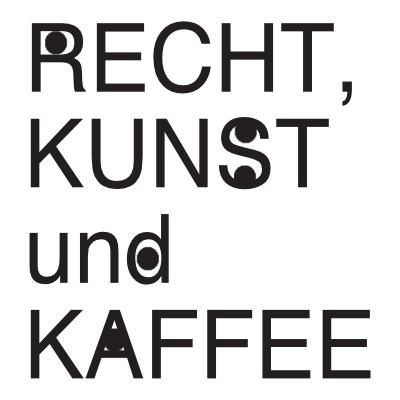Bildende Kunst
Ab wann genießt mein Werk Urheberrechtsschutz?
Was darf ich verwenden?
Welche Rechte räume ich dem Aussteller/Galeristen ein?
Was sollte beim Kauf/Verkauf von Kunstwerken beachtet werden?
Dürfen andere meine Kunstwerke fotografieren?
Welchen Preis sollte ich für meine Kunstwerke ansetzen?
Darf jemand ein Gemälde übermalen, anmalen, verändern?
Jemand hat mein Bild gekauft, aber der Rahmen passt mir nicht, kann ich das verhindern?
Was darf ich malen? Gibt es Verbotenes(z.B.Hakenkreuz)?
Was ist mit Stickern und Grafittis?
Muss ich das Einverständnis von Personen einholen, wenn ich diese fotografiere/male?
Was passiert bei Auktionen?
Ab wann genießt mein Werk Urheberrechtsschutz?
Ein Werk der bildenden Kunst hat - wie alle anderen Gattungsarten - Urheberrechtsschutz, sobald eine persönliche geistige Schöpfung vorliegt. Ab wann man von einer solchen sprechen kann, ist von Werkart zu Werkart unterschiedlich. Maßgeblich für den Begriff der „Schöpfung“ ist eine gewisse Individualität oder Originalität des Werkes, die es von der bloßen handwerklichen Leistung abhebt [hierzu: Dreier/Schulze/Schulze, 6. Aufl. 2018, UrhG § 2 Rn. 18].
Auch Werke Minderjähriger und Betrunkener/Berauschter genießen Urheberrechtsschutz, soweit eine persönliche geistige Schöpfung vorliegt (Nicht allerdings Tiere oder künstliche Intelligenzen).
Auch ein Objekt Trouvé - ein Werk welches bereits so vorgefunden - wurde kann Urheberechtsschutz genießen. Man denke an Skulpturen von Marcel Duchamp.
In der künstlerischen Praxis stellt sich die Frage der Schöpfungshöhe meist nur selten. Malerei erreicht bei vielen Pinselstrichen selbstverständlich schnell die nötige Schöpfungshöhe. Schwierig kann es bei Möbelstücken, minimalistischer Kunst und ähnlichem werden.
Was darf ich verwenden?
Darf ich als Künstler*in eine Vorlage aus dem Internet verwenden? Darf ich Collagen erstellen? Darf ich Markenlogos in meine Werke einbauen? Die Kunst, mit ihren unbegrenzten Möglichkeiten, lebt von Wiederholung, Aneignung, Zitat und vielem mehr. Für Jurist*innen ist es sehr schwer eine klare Antwort auf bestimmte Fragen von Künstler*innen zu geben. „Darf ich dieses Bild hier in mein Bild einbauen?“ Es kommt drauf an. Ohne das fertige Werk zu sehen ist es schwierig eine gute Einschätzung abzugeben. Dennoch kann man hier Künstler*innen Leitlinien an die Hand geben, an denen sie sich orientieren können.
Alles geht von dem Grundsatz aus, dass fremde Werke zunächst einmal - im Regelfall - urheberrechtlichen Schutz genießen (zur Schutzdauer hier). Damit soll u.a. verhindert werden, dass ohne Vergütung und Einwilligung des/der Ursprungsurheber*in, deren Werk verwertet wird. Allerdings kann es gute Gründe haben, dass man ein anderes Werk verwendet. Die Kunstrichtung der „Appropriation Art“ spielt damit, dass fremde Kunstwerke ganz oder teilweise kopiert werden. Dies kann viele Gründe haben: Hommagé an den Künstler, eine kritische Auseinandersetzung mit dessen Werk oder Sonstiges.
Auch Readymades, also Werke die einen Gegenstand verwenden, der bereits so vorgefunden, wie er ist, können fremdes Urheberrecht berühren. In den 30er-50er Jahren wurden bspw. Plakatwände ausgestellt, deren Schichten verschiedene Werbungen vermischten. Zu sehen war dann z.B. eine halbe Coca Cola Werbung mit einem Viertel Lucky Strike und noch einem weiteren Teil. Die Werbungen wären einzeln jeweils selbst urheberrechtlich geschützt.
Urheberrechtlich darf - aus Sicht des/der Künstler*in - also keine Vervielfältigung oder Bearbeitung des Ursprungswerkes vorliegen, da sonst eine Einwilligung des/der Ursprungsurheber*in notwendig ist. Vielmehr muss das neue Werk selbst eine neue persönliche geistige Schöpfung darstellen.
Ob die Verwendung im Einzelfall erlaubt ist hängt von einigen Faktoren ab. Wie viel vom Ursprungswerk wurde verwendet? Wurde ein zentrales Element des Ursprungswerkes verwendet, oder nur eher ein hintergründiges Element? Welchen Zweck verfolgte die Verwendung? Versucht der/die Verwender*in die Popularität des Werkes auszunutzen? All diese und weitere Fragen muss man sich stellen. Je mehr sich vom Ursprungswerk entfernt wird, desto sicherer entgeht man der Urheberrechtsverletzung.
Juristisch befinden wir uns oft in der Grauzone, sodass Anwält*innen Ihnen im Zweifel von einer Fremdverwendung abraten würden. Dies heißt jedoch nicht, dass ein Gericht es nicht anders sehen könnte. Dennoch kann eine gute Begründung im Zweifel vieles rechtfertigen. Wer den Konflikt scheut, sollte Vorsicht walten lassen.
Bei Appropriation Art, wie die von Elaine Sturtevant (sie gilt als Begründerin der Appropriation Art i.e.S.), die Andy Warhol Bilder 1:1 kopierte, wäre man wohl raus aus der Grauzone und drinnen in der Verletzungshandlung. Warhol ging jedoch nicht gegen Sturtevant vor, sondern unterstützte diese.
Jeff Koons wurde juristisch bereits öfters zur Beseitigung seiner Werke verpflichtet, weil er Skulpturen nach dem Vorbild fremder Fotografien erstellte. Dies mahnt dazu, dass auch der Wechsel in der Werkgattung nicht bereits reicht, um eine Benutzung zu rechtfertigen.
Welche Rechte räume ich dem Aussteller/Galeristen ein?
Sobald Künstler*innen in Galerien oder auch anderweitig öffentlich ausstellen machen sie von ihrem Ausstellungsrecht aus § 18 UrhG Gebrauch. Die Vorschrift soll sicherstellen, dass der/die Urheber*in selbst die Entscheidung treffen kann, wann das bisher unveröffentlichte Werk veröffentlicht, wird [Dreier/Schulze/Schulze UrhG § 18 Rn. 1-3]. In der Praxis bedeutet dies, dass wenn eine Galerie für Künstler*innen ausstellt, diese das Ausstellungsrecht einholen muss. Dies geschieht regelmäßig konkludent durch die Vereinbarung die Galerist*in und Künstler*in treffen. Auch wenn es oft keine schriftlichen Verträge gibt, so gelten auch die mündlichen Vereinbarungen.
Alles was nicht vereinbart wird, geht grundsätzlich zu Ungunsten der Galerie. Im Urheberrecht gilt der Grundsatz, dass im Zweifel eine Rechteeinräumung nicht gewollt war, solange diese nicht ausdrücklich vereinbart wurde.
Aus diesen Gründen sollte die Galerie sich, auch für Werbung mit den Bildern aus der Ausstellung, immer die Rechte bei dem/der Künstler*in schriftlich einholen.
Was sollte beim Kauf/Verkauf von Kunstwerken beachtet werden?
Wer Kunst kauft/verkauft sollte beachten, dass einige Besonderheiten zu berücksichtigen sind. Zwar handelt es sich im Regelfall um einen Kaufvertrag, dieser ist jedoch ggf. nach kunst- und urheberrechtlichen Maßstäben auszulegen.
Künstler*innen können ein Interesse daran haben, dass Sie auch nach dem Verkauf einen Zugriff auf das Werk haben. Aus diesem Grund ist es möglich, dass vereinbart wird, dass dem/der Künstler*in das Werk für Ausstellungen bereitgestellt werden muss. Bei diesem sog. Ausstellungsrecht sollte der Umfang angemessen und klar bestimmt werden. Der/die Künstler*in soll einerseits nicht monatlich Ausstellungen mit dem Werk bespielen dürfen, andererseits soll ihr/ihm der Zugriff auch nicht komplett untersagt werden. Angemessen scheint beispielsweise eine jährliche Nutzung für höchstens 2 Wochen.
Auch beim Weiterverkauf garantiert das Urheberrecht Künstler*innen einen Anteil am Verkaufserlös. § 26 UrhG regelt die Höhe des Anteils am Weiterverkaufspreis. Allerdings greift diese Regelung nur, wenn an dem Weiterverkauf ein/e Kunsthändler*in oder ein Versteigerer beteiligt sind und der Verkaufspreis 400 € übersteigt. Dennoch kann es für Künstler*innen ratsam sein, bereits in einen erstmaligen Kaufvertrag eine ähnliche Klausel mit aufzunehmen. Eine solche könnte beispielsweise lauten:
§ X Folgerecht:
Hiermit verpflichtet sich der/die Erwerber*in, den/die Künstler*in an einem Weiterverkauf mit 5% zu beteiligen.
In einem solchen Fall würde das Folgerecht nicht kraft Gesetzes, sondern durch den Vertrag entstehen.
Wichtig ist zu wissen, dass mit der Übergabe der Sache zwar das Eigentum übertragen wird, allerdings verbleiben jegliche Verwertungsrechte bei dem/der Urheber*in. So lange nichts ausdrücklich vereinbart wurde hat der/die Erwerber*in nicht einmal das Recht ein Foto des Bildes auf Social Media zu posten.
Auch öffentliche Ausstellungen - ohne Einwilligung des/der Urheber*in - sind mit dem bloßen Erwerb des Kunstwerks noch nicht erlaubt.
Auch das Urheberpersönlichkeitsrecht muss von dem/der Erwerber*in beachtet werden [mehr dazu hier].
Weitere Vertragselemente könnten eine Informationspflichtvereinbarung sein, wonach der/die Erwerber*in sich gegenüber den Künstler*innen verpflichtet, diesen Auskunft über die Höhe, Art und Vertragspartner*in bei einem Weiterverkauf zukommen zu lassen.
Auch kann ein Rückkaufsrecht für eine geplante Zerstörung des Werkes vereinbart werden.
Zuletzt ist es besonders wichtig, dass der Vertragsgegenstand so genau wie möglich definiert wird. Wird das Kunstwerk mit oder ohne Rahmen verkauft? Handelt es sich um ein Original, Druck oder Teil einer Serie? All dies kann zukünftige Rechtsstreitigkeiten vermeiden.
Ich habe Ihnen hier einen Mustervertrag aufgesetzt, den sie beliebig anpassen können. Beachten Sie, dass für die Nutzung jegliche Haftung ausgeschlossen ist!
Dürfen andere meine Kunstwerke fotografieren?
Das Fotografieren eines Kunstwerks an sich stellt noch keine urheberrechtlich relevante Handlung dar. Allerdings können Künstler*innen und Galerien in ihren Räumlichkeiten ein Fotografieverbot aussprechen. Dieses sollte deutlich sichtbar wahrnehmbar sein. Besucher*innen ist es dann (vor)vertraglich untersagt zu fotografieren. Bei Zuwiderhandlung können Galerie oder Künstler*in Löschung des Fotos verlangen.
Bei Veröffentlichung von Fotos ohne die Einwilligung des/der Urheber*in, kann diese/r Unterlassung und ggf. Schadensersatz verlangen. Hierzu mehr unter Allgemeines.
Darf jemand ein Gemälde übermalen, anmalen, verändern?
Ein großes Missverständnis in Teilen unserer Gesellschaft ist, dass die Absolutheit des Eigentums oft überschätzt wird. Der Gedanke „Ich darf damit machen was ich möchte“ gilt nicht. Schon unser Grundgesetz legt in der Eigentumsgarantie Schranken für das Eigentum fest. Eine dieser Schranken ist das Urhebergesetz.
Solange das Urheberrecht an einem Werk besteht, muss der/die Urheber*in Veränderungen an seinem Werk durch den Eigentümer grundsätzlich nicht dulden, § 14 UrhG [Entstellungsverbot]. Auch andere Bearbeitungen müssen vorher genehmigt werden.
Nur ausnahmsweise kann die Entstellung gerechtfertigt sein, sofern keine Interessen des/der Urheber*in beeinträchtigt werden (unwahrscheinlich) oder nach eine sorgfältigen Interessenabwägung das Recht am Eigentum überwiegt. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn das Werk dem Eigentümer aufgedrängt wurde (z.B. bei illegalem Graffiti).
Auch die komplette Zerstörung kann das Urheberpersönlichkeitsrecht tangieren [zu Änderungen und Entstellungen: Honscheck, GRUR 2007, 944].
Prominent wurde ein Fall aus den USA, wo Streetart- und Graffitikünstler*innen entschädigt werden mussten, die legal an einem Gebäude Kunstwerke gemalt hatten und diese dann weiss übermalt wurden wurde, ohne die Kunstwerke zu sichern [Nachzulesen: hier]. Der Fall wäre wohl auch in Deutschland ähnlich entschieden worden, mit Ausnahme der Schadensersatzhöhe.
Was ist mit Stickern und Grafittis?
Ist es Kunst oder Sachbeschädigung/Vandalismus? So in etwas fangen die meisten Zeitungsberichte an, die sich mit Graffiti beschäftigen. Dies impliziert fahrlässiger Weise, dass sich beides ausschließen würde. Dieses Missverständnis gilt es aufzuklären.
Natürlich entsteht Urheberrecht auch an Graffiti, sofern die Voraussetzungen (Schöpfungshöhe etc.) vorliegen. Es gibt gerade keine negative Voraussetzung, die besagt, dass nur legale Werke urheberrechtsfähig sind.
Allerdings ist fremdes Eigentum grundgesetzlich geschützt und dieses findet seine strafrechtliche Ausprägung in dem Tatbestand der Sachbeschädigung gemäß § 303 StGB. Durch das rechtswidrige Besprühen oder Bekleben von fremdem Eigentum erfüllt man also (meistens) den Tatbestand der Sachbeschädigung in der Tatbestandsvariante der Veränderung des Erscheinungsbildes (Schönke/Schröder/Hecker, 30. Aufl. 2019 Rn. 16, StGB § 303 Rn. 16).
Gleiches gilt wohl auch für das Erstellen von sog. Reverse-Graffitis (ebd.).
Muss ich das Einverständnis von Personen einholen, wenn ich diese fotografiere/male?
Wenn ich eine Person fotografiere, dann kann dies einen Eingriff in das Recht am eigenen Bild darstellen. In §§ 22, 23 KUG ist dies einfachgesetzlich geregelt. Geschützt wird die abgebildete Person nur vor der Verbreitung und öffentlichen zur Schaustellung des Bildnisses. Plant die Künstler*in also ein Bild zu veröffentlichen, sollten vorher die abgebildeten Rechte eingeholt werden.
Ausnahmen hiervon sind folgende (§ 23 KUG):
(1) Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte
Hierunter fielen eine Zeit lang alle Ereignisse an denen wenigstens ein Teil der Öffentlichkeit ein legitimes Informationsinteresse hatte. Also das gesamte politische, gesellschaftliche und kulturelle Leben. Durch Entscheidungen zu „Caroline von Monaco“ des EGMR wurde der Begriff etwas enger gefasst. Die Privatssphäre von abgebildeten Personen muss, trotz eines zeitgeschichtlichen Ereignisses, angemessen berücksichtigt werden [hierzu in aller Tiefe: Dreier/Schulze/Specht, 6. Aufl. 2018, KUG § 23 Rn. 10]. Die Rechtsprechung ist eher für Pressemedien interessant, als für Künstler*innen. Dennoch bietet der Fall einen guten Einblick in die Wichtigkeit von Persönlichkeitsrechten.
(2) Die Person ist lediglich Beiwerk der Landschaft oder Örtlichkeit
Selbstverständlich ist es nicht möglich, dass bei jedem Bild vom „Kölner Dom“ jede Person gefragt wird, ob man ihre Einwilligung in das Foto hat. Dennoch ist der Begriff des „Beiwerks“ schwer definierbar. Ich fotografiere eine Bäckerei, aus der ein Herr rauskommt, er ist nicht direkt erkennbar, Gesicht zur Bäckerei. Ist dieser Herr Beiwerk? Eine absolute Abgrenzung ist kaum möglich. Insbesondere individuelle Merkmale der abgebildeten Person, können diese das Bild prägen. Deswegen muss sich immer gefragt werden, ob die Personen eine lediglich untergeordnete Rolle in dem Bild spielen, oder eben aus ihrer Anonymität herausgelöst werden [Dreier/Schulze/Specht, 6. Aufl. 2018, KUG § 23 Rn. 35].
(3) Versammlungen, Aufzüge oder ähnliches
Wer an einer öffentlichen Versammlung teilnimmt, darf sich nicht wundern, dass er unter Umständen abgebildet wird. Einzelne Teilnehmer*innen dürfen nur dann fotografiert werden, wenn diese an besonderen Vorkommnissen beteiligt sind, oder etwas als Organisator der Veranstaltung in Erscheinung treten [s. Dreier/Schulze/Specht, 6. Aufl. 2018, KUG § 23 Rn. 42]. Auch Polizist*innen dürfen grundsätzlich als Teil des Versammlungsgeschehens fotografiert werden.
In allen anderen Fällen muss eine Einwilligung abgeholt werden. Für die Einwilligung gilt, dass ein Lächeln im Zweifel als Einwilligung gilt (§ 22 Satz 2 KUG). Vorsicht! Diese reine Beweislastregelung bedeutet eben nicht, dass ein Lächeln eine Einwilligung ist, sondern nur bei Zweifeln eine Einwilligung vermutet wird. Kann der andere Teil beweisen, dass es keine Einwilligung gab, hilft auch kein Lächeln.