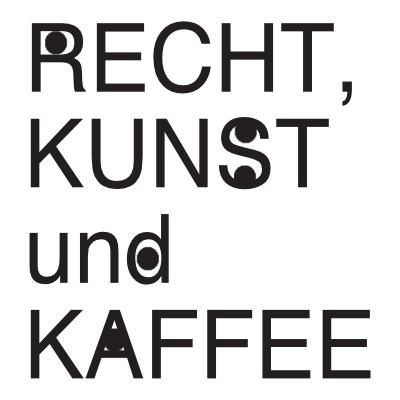Allgemein
Wozu gibt es Urheberrecht?
Was passiert wenn ich fremdes Urheberrecht verletze oder jemand mein Urheberrecht verletzt?
Wie viel muss jemand zahlen, der fremdes Urheberrecht verletzt?
Wie lange besteht das Urheberrecht?
Was bedeutet "gemeinfrei"?
Wie ist es in anderen Ländern?
Vor welchen Gerichten befinde ich mich bei Streitigkeiten um Kunst?
Wie teuer ist ein Rechtstreit für mich im Durchschnitt?
Wie gehe ich am besten vor, wenn jemand meine Rechte verletzt?
Was muss ich bei Verträgen beachten?
Muss ich meinem Werk ein Copyrightzeichen hinzufügen, um Urheberrecht zu erlangen?
Wozu gibt es Urheberrecht?
Dazu gibt es natürlich viele Theorien. In erster Linie geht es darum geistige und nicht materielle Leistungen zu honorieren und Künstler:innen und Kreativen einen Anreiz zu schaffen ihre Werke zu veröffentlichen. Ohne den Urheberrechtsschutz stünden Urheber*innen ohne Schutz dar. Jeder könnte ihre Werke ohne Probleme vervielfältigen, kopieren, verändern, nutzen usw.. Man sollte also dem Urheberrecht nicht mit einer Grundskepsis, sondern vielmehr einer allgemeinen Offenheit begegnen. Es ist selbstverständlich klar, dass durch die freie Verfügbarkeit im Netz, Debatten um Uploadfilter und soweiter sich das Verständnis fürs Urheberrecht wandelt. Die Existenz des Urheberrechts als Lebensgrundlage für Künstler*innen sollte man jedoch niemals aus dem Auge verlieren.
Was passiert wenn ich fremdes Urheberrecht verletze oder jemand mein Urheberrecht verletzt?
Wird Urheberrecht verletzt, so haben Urheber*innen (oder Verwertungsberechtigte) die Möglichkeit gegen Verletzer*innen vorzugehen. Es hängt also zunächst von der Entscheidung der Urheber*innen ab, ob diese gegen Verletzer*innen vorgehen. Im Internet wird sekündlich Urheberrecht verletzt. Trotzdem kommt wird nicht jede Urheberrechtsverletzung verfolgt. Das mag einerseits daran liegen, dass es manchen Urheber*innen egal ist, ob beispielsweise ein Bild von Ihnen verwendet wird, andererseits sich aber wohl auf Grund der Anonymität im Netz ein Vorgehen gegen einzelne Verletzer*innen nicht lohnt und schwerfällig ist. Dennoch sollte man fremdes Urheberecht nicht leichtfertig verletzen.
Urheber*innen haben vielerlei Ansprüche gegen Verletzungen des Urheberechts:
Urheber*innen haben einen Anspruch auf Unterlassung. Dieser ergibt sich aus § 97 I UrhG. Urheber*innen haben einen Anspruch auf Schadensersatz. Ein solcher ergibt sich aus § 97 II UrhG. Weitere Ansprüche ergeben sich aus den §§ 98 ff. UrhG.
Außerdem besteht die Möglichkeit, dass sogar eine strafbare Handlung vorliegt. Es drohen Geldstrafen und Freiheitsentzug von bis zu 3 Jahren. Im Fall einer gewerbsmäßigen Verwertung bis zu 5 Jahren Freiheitsstrafe. Diese setzt in den Fällen der §§ 106 ff. UrhG meist Vorsatz voraus. Gemäß § 109 UrhG ist hierfür grundsätzlich ein Strafantrag bei der Staatsanwaltschaft erforderlich, sodass die Urheber*in tätig werden müsste. Allerdings kann die Staatsanwaltschaft bei besonderem öffentlichem Interesse auch ohne Strafantrag Anklage erheben. Gewerbsmäßige Urheberrechtsverletzungen nach § 108a UrhG werden auch ohne Strafantrag ermittelt.
Somit sollte unbedingt vermieden werden fremdes Urheberrecht zu verletzen.
Wie viel muss jemand zahlen, der fremdes Urheberrecht verletzt?
Eine pauschale Antwort auf diese Frage kann man selbstverständlich nicht geben. Allerdings können einige Kriterien benannt werden:
Der Schadensersatz als solches kann durch 3 Methoden (dreifache Schadensberechnung) ermittelt werden. Durch die allgemeinen Regeln des BGB, Gewinnabschöpfung (§ 97 S.2 UrhG) oder Lizenzanalogie (§ 97 S.3 UrhG).
Nach den allgemeinen Regeln des BGB (§§ 249 ff. BGB) kann man konkreten Schaden einschließlich des entgangenen Gewinns vom Schädiger ersetzt verlangen. Diesen konkret zu ermitteln ist äußerst schwierig, eine kleine Hilfe bietet der entgangene Gewinn, also derj. Gewinn, der bei gewöhnlichem Lauf der Dinge erwartbar ist. Aber auch dieser Terminus, bzw. diese Art der Aus diesen Gründen hat der Gesetzgeber Urherber*innen ausdrücklich die Möglichkeit der Lizenzanalogie bereitgestellt. Bei dieser Methode wird ein Betrag ermittelt, den verständige Vertragspartner vereinbart hätten, wenn die Rechtsnutzung gestattet worden wäre (Schricker/Loewenheim/Wimmers, 6. Aufl. 2020, UrhG § 97 Rn. 271). Wie viel hätte man der Urherber*in für die Werkbenutzung üblicherweise zahlen müssen?
Dem Verletztem steht so ein Wahlrecht aus diesen drei Methoden vor. In der Gerichtspraxis ist es wichtig, dass die für den Anspruch günstigen und nötigen Tatsachen zu bewiesen sind. Der Vorteil liegt somit im Bereich der Lizenzanalogie, der
Um das Ganze plastischer zu machen, nun ein paar Beispiele:
Wie lange besteht das Urheberrecht?
Das Urheberrecht besteht bis 70. Jahre nach dem Tod der Urheber*in, § 64 UrhG. Dieses Ergebnis lässt sich in Suchmaschinen schnell recherchieren. Allerdings sollte man dennoch Vorsicht walten lassen.
Mozart ist gewiss schon über 70. Jahre Tod, sodass man seine Werke eigentlich ohne Probleme verwenden kann. Allerdings können hier Dritte andere Sachen geschützt haben. Noten oder Aufnahmen dürfen nicht einfach so verwendet werden. Hier kann es sein, dass ein verwandtes Schutzrecht besteht. Auch eine Fotoaufnahme eines Kunstwerkes von Albrecht Dürer kann Lichtbildschutz genießen. Aus diesem Grund, sollte man auch nicht einfach ohne weiteres Fotos alter Kunstwerke aus dem Internet verwenden.
Außerdem müssen Sie aufpassen, dass nicht ein etwaige Miturheber*innen vorhanden sind (§ 65 UrhG).
Es kann sein, dass ein Urheber bereits seit 70 Jahre verstorben ist, jedoch ein Miturheber noch nicht. In diesem Fall ist der längstlebende Urheber maßgeblich. Die Dauer des Schutzes der Beatles Songs bestimmt sich somit nicht zwangläufig nach dem Tod von John Lennon.
Für die Berechnung der Frist ist § 69 UrhG maßgeblich. Hiernach beginnt der Fristlauf mit Ablauf des Jahres in dem das maßgebliche Ereignis eingetreten ist.
Wie ist es in anderen Ländern?
Das Urheberrecht ist in allen Ländern unterschiedlich. Allerdings gibt es große Gemeinsamkeiten, sodass man regelmäßig Werkschutz in den meisten Ländern der Welt mit Werkschöpfung erhält. In der EU ist das Urheberrecht weitestgehend vereinheitlich. Allerdings steht den Staaten bei der Umsetzung von EU-Recht oftmals ein Spielraum zu, sodass es zu marginalen Unterschieden kommen kann.
Vor welchen Gerichten befinde ich mich bei Streitigkeiten um Kunst?
Urheberrecht wird vor den Zivilgerichten verhandelt. Je nach Streitwert befindet man sich in erster Instanz vor den Amtsgerichten oder vor den Landgerichten. Der Ort einer Klage hängt meist davon ab wo die Rechtsverletzung begangen wurde oder wo die/der Beklagte ihren/seinen Wohnsitz/Firmensitz hat.
Bei vorsätzlicher Urheberrechtsverletzung kann ein strafrechtlich relevantes Verhalten vorliegen. Dann wären wir bei den Strafgerichten, sodass auch die Amtsgerichte in erster Instanz zuständig sind.
Möchten Künstler*innen sich gegen Bescheide öffentlicher Institutionen wehren, z.B. eine Ablehnung einer Corona-Nothilfe befindet man sich vor den Verwaltungsgerichten.. Dies gilt auch für Genehmigungen von Veranstaltungen etc..
Arbeitsrechtliche Streitigkeiten werden vor den Arbeitsgerichten entschieden.
Außerdem gibt es, neben den Arbeitsgerichten, spezielle Theaterschiedsgerichte. Dort werden je nach Zuständigkeit theaterinterne Streitigkeiten entschieden. Die Theatergerichte sind neben u.a. auch mit Schauspieler*innen und anderen Personen aus dem Theaterbereich besetzt. Die Zuständigkeit bestimmt sich nach der BSchGO (Bühnenschiedsgerichtsordnung).
Wie gehe ich am besten vor, wenn jemand meine Rechte verletzt?
Das Vorgehen bei einer möglichen Rechtsverletzung variiert von Fall zu Fall. Dennoch kann man anhand eines kleinen Falles kurz das Grundschema skizzieren:
Es tritt folgender Fall ein. Sie sind unterwegs und sehen, dass jemand ein Bild, was sie gemalt haben, in einem Flyer verwendet. Hierin liegt eine Urheberrechtsverletzung i.S.d. § 16 UrhG. Es besteht nun ein Unterlassungsanspruch gemäß § 97 I UrhG gegen den Verletzenden.
Nun sollten Sie wie folgt vorgehen:
Sie sollte zunächst die Beweise sichern (in diesem Fall den Flyer aufheben; findet eine Verletzung im Internet statt, sollten Sie zumindest einen Screenshot machen).
Nun könnten Sie direkt eine Kanzlei aufsuchen. Sinnvoll ist es jedoch oft auch, einfach das Gespräch mit dem Verletzenden zu suchen. Außerdem können Sie in diesem Atemzug auch den Verletzenden abmahnen. Die Abmahnung wird relevant für einen späteren Prozess. Wurde nicht abgemahnt kann der Beklagte ggf. den Anspruch sofort anerkennen, sodass der Kläger die (Gerichts-)Kosten tragen muss.
Je nach Art der Verletzung bietet es sich an von dem Verletzendem die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung zu verlangen.
All dies könnten Sie, auch ohne anwaltliche Hilfe, tun.
Reagiert das Gegenüber nicht auf ihre Anfragen und Mahnungen nicht sollten Sie nun gerichtliche Hilfe in Anspruch nehmen (z.B. Klage).
Anwält*innen würden sich vor einem Rechtsstreit als erstes die Frage stellen, ob ein gerichtliches Vorgehen Aussicht auf Erfolg hat. Dazu prüfen diese unter anderem, ob der Anspruch überhaupt besteht. Als Laie kann man dies mitunter leider nur äußerst schwer einschätzen.
Nehmen Sie sich also im Zweifel Hilfe eines/einer Anwält*in. Insbesondere bei Streitwerten über 5000 € ist eine anwaltliche Vertretung vor Gericht unabdinglich. Auch bei geringeren Streitwerten kann eine anwaltliche Vertretung ratsam sein.
Muss ich meinem Werk ein Copyrightzeichen hinzufügen, um Urheberrecht zu erlangen?
Nein, auch wenn gerade Fotografen gerne ein Copyrightzeichen unter, oder auch auf ihre Bilder machen ist dieses nicht Voraussetzung für den Urheberrechtsschutz. Allerdings kann es helfen zur Identifizierung von Urhber*innen beizutragen. Auch im englischsprachigem Raum kann es durchaus nützlich sein, das Copyrightzeichen zu verwenden.