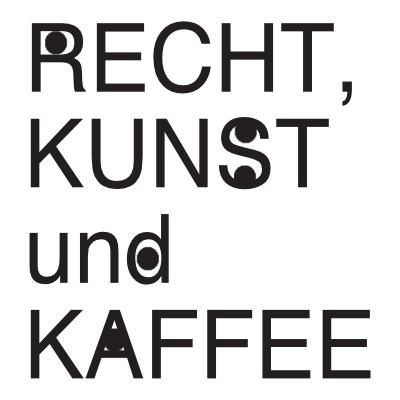Autor*innenfragen
Ab wann hat ein Text Urheberrecht?
Wer hat welche Rechte, wenn ich etwas veröffentliche?
Was ist die VG-Wort?
Was ist eine angemessene Vergütung?
Darf eine Zeitung meinen Text bearbeiten/redigieren?
Wie zitiere ich richtig?
Muss ich mich selbst zitieren?
Was darf ich schreiben?
Was muss beachtet werden, damit nicht rechtswidrig Persönlichkeitsrechte verletzt werden?
Was ist Verdachtsberichtserstattung und wie funktioniert diese?
Ab wann hat ein Text Urheberrecht?
Texte setzen, wie alle anderen Gattungsformen im Urheberrecht, eine geistige persönliche Schöpfung voraus, um Urheberrechtsschutz zu erlangen. Sprachwerke können Werke der Literatur, Zeitungstexte, Werbetexte, wissenschaftliche Texte und auch das gesprochene Wort sein. Voraussetzung für den Urheberschutz ist allerdings eine notwendige Individualität und Gestaltungshöhe. Auch hier gilt – wie bei anderen Werktypen - für die Gestaltungshöhe der Begriff der „kleinen Münze“. Die somit niedrigste Stufe eines Werkes, z.B. banalste Geschichten oder Gedichte, erwerben Urheberrechtsschutz [Loewenheim UrhR-HdB, § 9 Die Werkarten Rn. 19]. Individualität ergibt sich aus dem Inhalt oder der Gestaltung des Werkes [ebd. Rn. 18].
Schreibe ich etwas, was in seiner Ausgestaltung oder Alltäglichkeit keinen Raum für Individualität lässt – z.B. „Elefanten sind grau“ – muss sich die Individualität aus anderen Teilen des Werkes ergeben.
Grenzfälle ergeben sich wohl bei konkreter Kunst, Nacherzählungen von bekannten Sagen/Märchen und vor allem bei kurzen Texten. Die Kürze an sich ist jedoch kein Kriterium, ob letztendlich Urheberrechtsschutz vorliegt oder nicht. In der Praxis kann man sich somit grundsätzlich in Sicherheit wiegen, dass geschriebene und gesprochene Texte im Regelfall urheberrechtsfähig sind.
Was ist die VG-Wort?
Die VG-Wort ist eine Verwertungsgesellschaft für die gemeinsame Verwertung von Urheberrechten von Autor*innen und Verlagen. Über ein Verteilungssystem soll versucht werden Autor*innen und Verlage angemessen zu vergüten. Ist ein/e Autor*in Mitglied der VG-Wort, so können Dritte bestimmte Werknutzungen über die VG-Wort lizensieren lassen. Außerdem bietet die VG-Wort Unternehmen und anderen Institutionen eine Copyrightlizenz an, die es erlaubt eine Vielzahl von Textquellen zu verbreiten und vervielfältigen. Der Gewinn hieraus wird unter den Mitgliedern ausgeschüttet. Außerdem gibt es verschiedene Modelle für Schulen und Hochschulen, die so Lizensierungen für die Kopiemöglichkeiten erhalten. Auch Bibliotheken und Lesezirkel müssen teilweise eine Abgabe an die VG-Wort leisten. In bestimmten Fällen übernimmt die GEMA die Einbeziehung und rechnet mit der VG-Wort ab (so z.B. wenn Hotels Sprachwerke über Radio und Fernsehgeräte abspielen).
Der gesamte Umfang und Tätigkeitsbereich ist sehr weit, sodass sich ein Blick auf die Homepage der VG-Wort lohnt.
[Quelle: Homepage der VG-Wort: https://www.vgwort.de/]
Darf eine Zeitung meinen Text bearbeiten/redigieren?
Wenn Sie als Autor*in die Möglichkeit haben in einer Zeitung (oder anderes Publikationsmedium) etwas zu veröffentlichen, dann stellt sich die Frage, inwieweit die Zeitung - ohne ihre Zustimmung - den Text verändern darf. Darf sie den Text kürzen, korrigieren oder sogar inhaltlich Bearbeiten? Wenn Sie Angestellte*r des Publikationsmediums sind, dann müssen Sie, soweit nichts anderes vereinbart worden ist, angesichts ihrer arbeitsrechtlichen Treuepflicht, eine Vielzahl an Änderungen akzeptieren. Hier hängt es natürlich auch davon ab, ob der Text unter Ihrer Namensnennung veröffentlicht wird oder nicht. Wird ihr Name genannt, müssen größere Veränderungen, wegen des Urheberpersönlichkeitsrechtes, mit Ihnen abgesprochen werden. Sind Sie freie*r Journalist*in, oder Schreiben Sie einen Leser*innenbrief, so greift eine Bearbeitung, die über bloße grammatikalische Korrekturen hinausgeht, in § 23 UrhG ein. Dies wäre ohne Ihre Zustimmung nicht erlaubt. Ob es sich bei einer bloßen Kürzung des Textes um eine Bearbeitung handelt, hängt im Zweifel davon ab, ob der Text dadurch in seinem Sinn beeinträchtigt wird.
Muss ich mich selbst zitieren?
Zunächst scheint diese Frage etwas komisch, doch wer wissenschaftliche Arbeiten zitiert, der findet oft Personen, die sich selbst zitieren. Dies hat nicht unbedingt mit Eitelkeiten und Narzissmus zu tun, sondern dient oft der Absicherung. Es kann sein, dass die Verwertungsrechte nicht mehr bei einem selbst liegen, sondern bei einem Verlag. Dementsprechend muss ich mich selbst zitieren.
Ein weiterer Fall (denkbar, aber vermutlich selten): In dem eigenen (Ursprungs-)Text kann eine fremde Quelle zitiert sein. In dem neuen Werk soll jedoch der (eigene) Gedanke fortgeführt werden. So kann der/die Leser*in zumindest im alten Text den Quell des Gedankens finden, obwohl das Zitat nur den eigenen Teil aufgreift.
Außerdem kann es sein, dass im Ursprungswerk ein*e Miturheber*in zu finden ist. Dann muss ich als Einzelperson, auch wenn ich den Text mitgeschrieben hatte, auch den/die Miturheber*in zitieren und somit mich selbst auch.
Was darf ich schreiben?
Die Kunst und die Meinungsfreiheit finden ihre Schranken in den allgemeinen Gesetzen. Dies bedeutet grob, dass die Meinungsfreiheit und die Kunstfreiheit durch ein Gesetz eingeschränkt werden können. Allerdings ist dieses Gesetz wiederum im Lichte der Meinungsfreiheit auszulegen. Was das genau meint lässt sich kurz am Ehrschutz skizzieren (Juristen bitte ich die Verkürzung zu entschuldigen!): In Buch „X“ schreibt Autor Y herablassend über den Z. Es könnte nun sein, dass eine Beleidigung im Sinne des § 185 StGB vorliegt. Der Beleidigungsparagraf im Strafgesetzbuch ist ein allgemeines Gesetz. Jetzt müsste ein Richter subsumieren, ob das Herablassende eine Beleidigung ist. Hierbei muss er jedoch die Besonderheiten von Kunst und Meinungsfreiheit berücksichtigen.
Exkurs: Ein allgemeines Gesetz liegt dann vor, wenn es nicht darauf abzielt eine bestimmte Meinung an sich zu verbieten. Dementsprechend kann ein Gesetz niemals verfassungsgemäß sein, welches verbietet ganz bestimmte Meinungen verbietet, seien sie noch so absurd, gefährlich etc..
Eine Reihe von Entscheidungen die eine Orientierungshilfe bieten, was erlaubt ist und was nicht, findet ihr unter Entscheidungen.
Was muss ich beachten, damit ich nicht rechtswidrig Persönlichkeitsrechte verletze?
Persönlichkeitsrechtsverletzungen können äußerst teuer werden. Im deutschen Recht genießt das allgemeine Persönlichkeitsrecht Grundrechtsschutz. Der Gesetzgeber schützt dies über § 823 I BGB analog. Hiernach kann Unterlassung und Schadenersatz verlangt werden, wenn jemand rechtwidrig Persönlichkeitsrechte verletzt.
Eine Maßgebende Entscheidung hierzu war die Entscheidung „Esra“ des BVerfG [Beschluss vom 13. Juni 2007, Az. 1 BvR 1783/05 ]. Maxim Biller schrieb einen fiktiven Roman, in dem der Protagonist eine Liebesaffäre mit einer in Deutschland lebenden Türkin hatte. Die Klägerin fand sich in dem Werk wieder und behauptete, dass die Parallelen für Außenstehende erkennbar seien. Der Streit ging vom LG, über den BGH bis zum BVerfG (Jurist*innen mögen die Vereinfachung entschuldigen). Dieser musste zwischen der Kunstfreiheit und dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht der Klägerin (u. ihrer Mutter) abwägen.
Das allgemeine Persönlichkeitsrecht schützt insbesondere vor (erheblichen) verfälschenden und entstellenden Darstellungen. Das BVerfG stellte in der „Esra“-Entscheidung fest, dass die Personen erkennbar sind. Maßstab hierfür ist ein mehr oder minder großer Bekanntenkreis. Es ist hierbei nicht auf Prominente beschränkt, auch ein naher Bekanntenkreis reicht ggf. aus. Bloße Indizien reichen allerdings nicht für die Erkennbarkeit aus. Sonst würden Künstler*innen darin beschränkt sich notwendige Inspiration aus der Wirklichkeit zu holen.
In dem Fall „Esra“ hatte sich die Erkennbarkeit allerdings förmlich aufgedrängt. Hier stimmten viele Daten der fiktiven Person mit der Klägerin überein. Außerdem wurde in dem Roman der 17-Jährigen türkischen Protagonistin ein Preis verliehen, wie auch in der Wirklichkeit.

Der/die Klagende darf auch nicht bloß geringfügig betroffen sein und die Kunstfreiheit muss sich ihrerseits nicht jede Einschränkung durch das Persönlichkeitsrechts gefallen lassen. Ansonsten würden ihr inhaltlich unzulässige Grenzen auferlegt werden. Aus diesem Grund erfolgt eine verfassungsrechtliche Abwägung.
Im Rahmen der Abwägung werden Schwere, Intensität und Art der Persönlichkeitsrechtsverletzung berücksichtigt. Außerdem stellt sich die Frage inwieweit sich Leser*innen aufdrängt, dass es eine Geschichte aus der Wirklichkeit ist, oder bloße Fiktion (ein Disclaimer reicht nicht aus). Insbesondere eine Berührung des höchstpersönlichen Lebensbereichs (Intimsphäre) muss nicht hingenommen werden.
Für die Entscheidung bedeutete dies, dass die besonders detaiierte, realistische Erzählweise dem Autor auf die Füße fiel. Außerdem wiegte die Persönlichkeitsrechtsverletzung schwer, dass über die lebensbedrohliche Krankheit der Tochter der Protagonistin erzählt wurde (Arg. Mutter-Tochter-Beziehung und Mitschüler*innen).
Beim Schreiben eines Textes mit Wirklichkeitsbezug sollten Sie also insbesondere auf das Maß achten. Kann ich abstrahieren oder Fiktionalisieren? Welche Sphäre ist betroffen? Intimsphäre sollte gar nicht berührt werden, Privatsphäre nur in bedächtiger Weise.