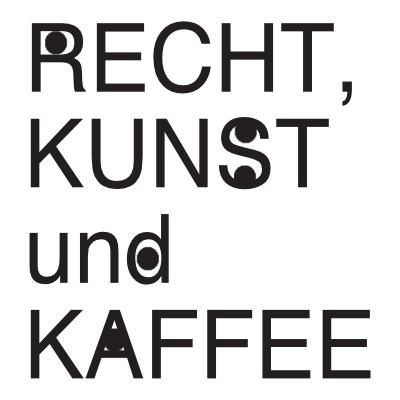Grafikdesign, Digitalkunst und NFT
Welche Besonderheiten ergeben sich bei digitaler Kunst und Designs?
Genießt Schrift/Typografie auch (Urheberrechts-)Schutz?
Welche Besonderheiten ergeben sich bei digitaler Kunst und Designs?
Das grundsätzliche juristische Problem von digitaler Kunst ist, dass diese nicht verkörpert ist. Auch Vervielfältigungen finden im digitalen Bereich anders statt als im analogen Bereich. Auch sind einzelne Probleme sehr technisch. Dementsprechend kann es zu großen Unterschieden kommen im Gegensatz zur bildenden Kunst.
Auch gibt es gerade im Designbereich das spezielle Designgesetz, sowie das Markengesetz und das Patentgesetz. Diese können auf dieser Seite jedoch nur am Rande besprochen werden.
Auch im Rahmen der Kryptokunst (z.B. NFTs) gibt es Besonderheiten, die es für Künstler*innen zu beachten gilt.
Genießt Schrift/Typografie auch (Urheberrechts-)Schutz?
Schriften sind allgegenwärtig. Helvetica oder Times, Serifen oder keine Serifen, Bold, Inverted, etc., Grafikdesigner*innen und Typograf*innen stehen vor einer immensen Auswahl an Schriften. Gerade junge Designer*innen versuchen sich oft an eigenen Schriften. Allerdings sind (Grund-)Formen für Buchstaben bereits vorgegeben. Können Schriften also urheberrechtlichen Schutz genießen?
Schmuckbuchstaben können urheberrechtlichen Schutz erlangen, wenn die Verzierung hinreichend individuell ist (nötige Schöpfungshöhe; Maßstab: kleine Münze). Auch Kalligrafie (je nach und Schriften mit hoher Gestaltungshöhe können Urheberrechtsschutz erlangen.
„Einfache“ Schriften, wie neuere veränderte Versionen bekannter Schriften erlangen keinen selbständigen Urheberrechtsschutz. Allerdings hat Deutschland sich, durch Unterzeichnen des Wiener Abkommens, dazu verpflichtet Schutz für Schriftzeichen zu schaffen. Das ehemalige Schriftzeichengesetz wurde durch das Designgesetz abgelöst. In § 61 DesignG (ehemals Geschmacksmustergesetz) ist der Schriftschutz geregelt.
Hierbei sind einzelne Buchstaben nicht schutzfähig. Maßgeblich für die Schutzfähigkeit ist das Schriftbild, welches sich aus einer zusammengehörenden Anzahl von Buchstaben, Ziffern und Zeichen ergibt [so Kühne/Meiser, in § 61 DesignG, Rn. 4 Eichmann/Jestaedt/Fink/Meiser, Designgesetz, GGV].
Die Schrift muss sich zudem als Neuheit und als eigentümlich erweisen. D.h., dass hier Stil und Gesamteindruck einem einheitlichen Formgedanken folgen. Bei der Bewertung wird man den Fachkreis von Typograf*innen hinzuziehen müssen [s. Kühne/Meiser]. Hierbei empfiehlt es sich erfahrene Kolleg*innen zu befragen, ob eine „neue“ individuelle Schrift in deren Verständnis vorliegt. Der gerichtliche Sachverständige wäre im Zweifel auch ein*e Kolleg*in von Ihnen.
Verständnishalber muss aber erwähnt werden, dass § 61 DesignG als eine Übergangsvorschrift gedacht ist und zudem eine Anmeldung voraussetzt [s. Kühne/Meiser §61 DesignG, Rn. 2]. In der Praxis werden allerdings kaum Schriften über das DesignG geschützt.
Es stellt sich also die Frage, wie auch nicht eingetragene Schriftzeichen Schutz erlangen? Man stelle sich vor, dass Sie eine Font auf einer bekannten Fontplattform (z.B. dafont.com) hochladen. Dürfen andere diese Schrift verwenden, wenn diese die downloaden? Nein, denn auf den Fontplattformen verpflichtet man sich oft, die Schriften nur zu privaten Zwecken zu verwenden. Eine Lizenz für eine kommerzielle Nutzung kostet. Und genau so lassen sich Schriften für Grafikdesigner*innen schützen, indem man den Erwerb der Schrift kommerzialisiert. Die Käufer*in verpflichtet sich beim Download entweder vertraglich (z.B. AGB der Webseite) oder anders, die Schrift nur zu privaten Zwecken zu nutzen oder eine entsprechende Lizenzgebühr zu entrichten. Bei einer kommerziellen Nutzung – ohne entsprechende Lizenz - kommt so ein Schadensersatzanspruch in Betracht.